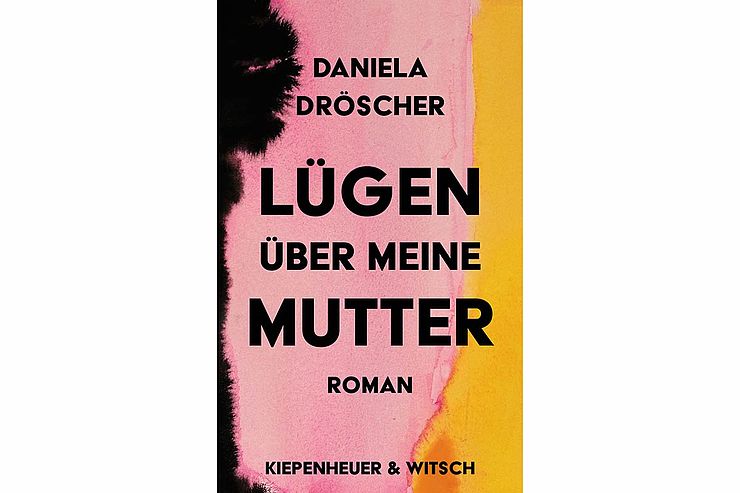Die Wahrheit in der Lüge
Es gibt viele Lügen über die alte BRD. Eine der größten ist, dass sie eine »nivellierte Mittelschichtsgesellschaft« gewesen sei. Auch wenn sie für viele Menschen das Versprechen auf materiellen Aufstieg in die Mittelschicht einlöste, besteht die Lüge darin, dass sie sich dort als Gleiche unter Gleichen begegneten. Denn mit dem Versprechen auf Gleichheit ging oft die stille Forderung nach Gleichförmigkeit einher, und damit das krachende Scheitern, wenn jemand dieser Forderung nicht nachkommen konnte.
Dieses Scheitern ist das Begleitgeräusch zur Geschichte der Mutter, die Daniele Dröscher in ihrem Roman »Lügen über meine Mutter erzählt«. Denn diese Mutter ist nicht gleichförmig, sondern unförmig — zumindest in den Augen ihres Ehemanns: »Meist begann der Streit am Abend, wenn mein Vater aus dem Büro kam und sich darüber beklagte, dass er seine Frau › zu dick‹ fand. Heute hatte er schon beim Frühstück damit angefangen.«
Dies erzählt Ela, das autofiktionale Alter ego von Daniela Dröscher. Es ist Mitte der 80er Jahre, und Ela wird gerade eingeschult. Dröscher, Jahrgang 1977, streut in ihren Text immer wieder Zeichen ein, die ihn historisch verorten: Tschernobyl und Wackersdorf, die Challenger-Katastrophe, Perestroika und die Grünen als Vorboten eines politischen Wandels, Stern und Geo. Und den Streit ihrer Eltern beschreibt Ela als »Kalten Krieg«. Es sind Zeichen einer historischen Periode, die kurz nach der vier Jahre andauernden Romanhandlung an ihr Ende gelangte. Es ist die Zeit der alten BRD.
Mittendrin liegt das kleine Dorf im Hunsrück, wo Ela aufwächst. Auf Wunsch des Vaters ist die Familie nach der Hochzeit aus der Großstadt dorthin gezogen. Elas Vater arbeitet als Maschinentechniker, die Mutter als Fremdsprachenkorrespondentin — beide in einem mittelständischen Unternehmen. Dass es soweit kommen konnte, ist eine biographische Anomalie. Ihr Vater stammt aus einer Bauernfamilie, ihre Mutter ist die Tochter eines Bergmanns, die im Alter von sechs aus Schlesien nach Deutschland gekommen ist. Ihre Herkunft verfolgt die beiden Elternteile auf unterschiedliche Arten. Die Mutter will sich in ihrem Job verbessern, aber wird durch die Sorgearbeit für ihre Kinder und die demente Mutter davon abgehalten. Sie bemüht sich nach außen hin um Ehrlichkeit, und will damit Vorurteilen über die angebliche »Schlitzohrigkeit« polenstämmiger Menschen entgegnen. Der Vater hat sich seinen pfälzischen Dialekt abtrainiert, der nur dann noch hervorbricht, wenn er wütend wird.
Und das wird er oft. In seinem Job stößt er an die gläserne Decke, an die Bildungsaufsteiger aufgrund ihres Habitus oft stoßen, aber er macht dafür vor allem den Körper seiner Frau verantwortlich: »Er ließ sich in einer Ecke des Tisches auf den Stuhl fallen und schaute meine Mutter düster an. Die Beförderung könne er sich abschminken, das sei ihm heute klar geworden. Ein Mann ohne eine vorzeigbare Frau würde eine solch gehobene Stellung niemals bekommen.«
Um diese »vorzeigbare Frau« zu werden, zwingt Elas Vater ihrer Mutter immer neue Diäten auf. Auch sie sind Relikte der Zeit: Besuche bei den Weight Watchers, Trennkost, »Friss die Hälfte«. Schließlich soll ein Ballon im Magen den Appetit zügeln. All dies nutzt nichts. Seine Obsession mit der Figur seiner Frau ist dabei nur eine Facette des Statusdenkens, das Elas Vater in seinem Heimatdorf nach außen trägt.
Er protzt mit einem Cabrio und der Mitgliedschaft im Tennisclub. Er fährt in Skiurlaub und verspekuliert Geld im Börsenboom der 80er Jahre. In die Familienkasse zahlt er nicht ein. Den Alltag finanziert Elas Mutter, zuerst mit ihrem Einkommen als Fremdsprachenkorrespondentin und dann mit dem Erbe ihres eigenen Vaters. Es ist dieses Erbe, das das Statussymbol schlechthin finanziert: den Neubau des Einfamilienhauses, inklusive Fitnesskeller und Wintergarten. Denn die größte Lüge über Elas Mutter ist, dass sie die Mittelschichts-Existenz der Familie gefährde. Das Gegenteil ist der Fall: Sie macht sie erst möglich.
Daniela Dröscher macht den Körper ihrer Mutter zum Schauplatz der Auseinandersetzung mit dem Patriarchat
Daniela Dröscher macht den Körper ihrer Mutter zum Schauplatz der Auseinandersetzung mit dem Patriarchat, die auch vor ihrem kindlichen Alter Ego Ela nicht Halt macht. »Ich — schämte — mich — für — meine — Mutter«, denkt diese bei einem gemeinsamen Besuch im Freibad: »Ich konnte mir den Körper meiner Mutter nicht auf einer Liegewiese vorstellen.« Aber für ihre Scham besteht kein Anlass: Die abwertenden Blicke der Freibadbesucher*innen, die Ela nach den Tiraden ihres Vaters erwartet — sie bleiben aus.
Man kommt nicht als ›dicke Frau‹ zur Welt, man wird es. Mit Hilfe ihrer Erzählerin Ela schildert Dröscher diesen Prozess mit der Beobachtungsgabe eines neugierigen Kindes. Sie hinterfragt die Schönheitsnormen noch, die sie eigentlich verinnerlichen sollte. Sie durchschaut die Distinktionsspielchen ihrer Familie nicht und schildert sie daher mit Naivität und einer Detailfülle, die auf Erwachsene befremdlich wirkt, und gerade dadurch diese Spielchen sichtbar macht. Aber die kindliche Erzählstimme stellt die Autorin Dröscher vor ein Problem: Wie soll sie die biographische Reflektion leisten, die ein autofiktionaler Text verlangt? Dröscher löst dies, indem sie kurze Einschübe ihrer Persona als Autorin Mitte 40 einfügt. Dort beschreibt sie die Wutausbrüche und Übergriffigkeiten des Vaters als »Protestmännlichkeit«, die durch ein Gefühl der politischen Ohnmacht gekennzeichnet ist. Sie freut sich darüber, dass junge Feminist*innen eine Sprache für mehrgewichtige Frauenkörper gefunden haben. Und sie bittet ihre Mutter darum, ihre Ehe einzuschätzen: »Wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, würdest du noch einmal Mutter werden? Hast du es bereut?« »Bereut?« Jetzt ist sie es, die empört reagiert. »Wie kann ich die Existenz meiner Kinder bereuen?«
»Lügen über meine Mutter« ist ein um Verständnis bemühtes Buch. Das unterscheidet es vom Gros der autofiktionalen Texte, die in den vergangenen Jahren für Aufsehen gesorgt haben. Dröschers Roman geht die drastische Anklage ab, mit der Édouard Louis gegen die französische Klassengesellschaft agiert. Auch lässt sich Dröscher nicht auf den nach Auflösung der Familie strebenden Schreibrausch ein, den Kim de l’Horizon in »Blutbuch« zeigt. Und wo Annie Ernaux’ Schilderungen die psychologischen Abhängigkeiten ihrer eigenen Kindheit schmerzhaft und umittelbar deutlich machen, zeigt Dröschers Ela eine erstaunlich reife Empathie für den Schmerz ihrer Mutter. Aber vielleicht passt genau diese Erzählhaltung gut zu der Geschichte des Landes, von der Daniela Dröscher eine kurze Episode schildert. Denn auch wenn wir heute die Unzulänglichkeiten der alten BRD und den Schmerz, den sie verursacht hat, deutlich zu benennen wissen — mit ihr brechen wollen nur die wenigsten.
Daniela Dröscher: »Lügen über meine Mutter«, KiWi, 448 Seiten, 24 Euro