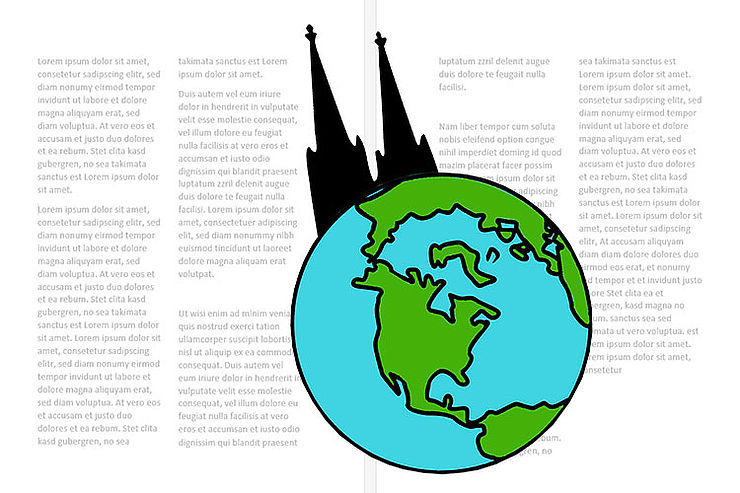Der Huster
Wo ich war, war immer ein Husten. In jeder Siedlung, wo ich wohnte, wohnte auch ein Huster. Nie sieht man sie, doch hört man sie, denn der Huster hat stets ein Fenster geöffnet, auf dass es jeder wissen kann: Er ist da, und er hustet seinen Husten. Warum? Das Phänomen des Husters scheint erstaunlich genug, doch noch erstaunlicher ist, dass nie zwei Huster gemeinsam zu hören sind — von Lungenheilanstalten und Kammermusikkonzerten einmal abgesehen. Stecken Huster ihr Revier ab, gleich Piepmatz, Isegrim und Meister Petz? Fügt sich womöglich der schwächere Huster dem stärkeren und verlegt sich — auf Niesreiz oder Flatulenz? Gern würd ich den Huster danach fragen, doch er ist scheu wie ein Tier, das seine drohenden Laute aus dem Dickicht erschallen lässt.
Ich lebte einmal in einem Hochhaus, recht weit oben, ich hätte ich mich wie der Vorstandsvorsitzende auf der Chefetage eines DAX-Konzerns fühlen können. Denn ich saß oft einfach nur herum, ließ die Zeit verstreichen und hoffte, dass alles gutgehen würde — wie jemand, der alles delegiert hat und nichts anderes mehr tun braucht als die Verantwortung zu tragen, um sie im Zweifelsfall von sich zu weisen.
Wenn ich das Fenster öffnete, sah ich nicht nur, sondern spürte ich nachgerade eine mächtige Leere, die sich zwischen dem Hochhaus, in dem ich wohnte, und der gegenüberliegenden Häuserzeile, nicht minder kolossal, auftat. Sie war auch ein akustisches Erlebnis, der Lärm der Straßen drang bloß noch dumpf und matt zu mir nach oben, so als habe ihn der Weg hinauf zu mir erschöpft.
Diese Stille wurde nur einmal in der Woche unterbrochen, sonnabends in der Früh, wenn im Block gegenüber sich die ersten drei Fenster öffneten. In die Leere hinein schallten dann nämlich zugleich die Geräusche von Geschlechtsverkehr, ein nicht enden wollendes Husten samt Auswurf sowie das immer gleiche Death-Metal-Album. Alle drei Geräuschquellen mündeten in ein akustisches Triptychon des Niedergangs: Zeugung — Krankheit — Tod. Ich kann nicht behaupten, dass mich diese allsamstägliche Parabel zum Auszug aus dem Hochhaus bewogen hätte, gewissermaßen war ich auch fasziniert, so wie man von allem Verstörenden immer auch fasziniert ist. Bald aber war ich’s leid. Selbst das Verstörendste ist irgendwann bloß noch störend. Heute lebe ich in einer Siedlung, wo man samstags bohrt, an seinem Auto bastelt oder meint, das ohnehin blitzeblanke Treppenhaus putzen zu müssen. Doch auch hier gibt es einen Huster gegenüber im Haus, man hört ihn täglich, nicht nur samstags. Jeder Huster ist wohl anders, der eine hustet gern zu Sex und Death Metal, ein anderer tagein, tagaus, gleich so, wie’s ihm gefällt. Ich kann daher ausschließen, dass der Huster mich verfolgt. Aber die Vorstellung, dass es in der Stadt eine geheime Gesellschaft der Huster gibt, die die Siedlungen unter sich aufgeteilt haben, ist nicht weniger beunruhigend. Rock ’n’ Roll sei keine Lärmbelästigung, sangen dereinst AC/DC. Eben dies über den Husten zu behaupten, käme selbst der hartgesottensten Rockband nicht in den Sinn.
Heute sitze ich kaum noch herum, wie damals in dem Hochhaus. Ständig muss ich heutzutage »noch was machen«, und ich lasse auch nicht mehr die Zeit verstreichen, sondern die Zeit scheint vielmehr mich verstreichen zu lassen. Nur dass alles gut geht, hoffe ich noch immer. Oder werde auch ich irgendwann einen unguten Husten in die Welt hinausbellen — der Worte überdrüssig, die ohnehin nicht beschreiben können, was man fühlt angesichts dessen, was in der Welt vor sich geht? Worüber man nicht reden kann, darüber muss man husten. Mir scheint, das Husten nimmt zu.