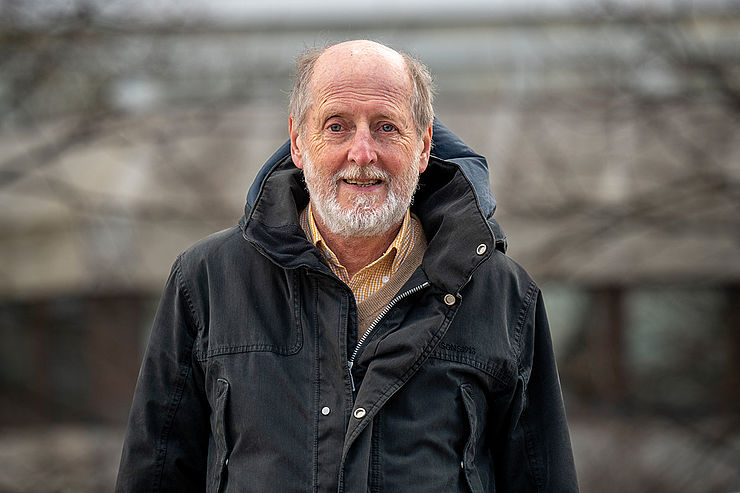Graue Energie
Architekten und Klimaschützer fordern ein Abriss-Moratorium. Die in den Gebäuden steckende Graue Energie soll nicht verschwendet werden. In Köln wird gerade über die Zentralbibliothek und das Justizzentrum gestritten, aber unzählige weitere Gebäude überschreiten demnächst ihr Haltbarkeitsdatum — was bedeutet die Debatte für sie? Und warum sind Sanierungen umständlicher und oft auch teurer als Abriss und Neubau? Wir haben mit Fachleuten gesprochen, Dörthe Boxberg hat sie und die umstrittenen Gebäude fotografiert
Stefanie Ruffen steht im obersten Stock der Zentralbibliothek und blickt auf den Josef-Haubrich-Hof. Der Himmel ist so grau wie das kiesgedeckte Flachdach über dem Eingang und die Tauben, die sich darauf niedergelassen haben. »Die Zentralbibliothek ist kein schlechtes Gebäude«, sagt Ruffen. Die FDP-Politikerin ist die Vorsitzende des Bauausschusses und selbst Architektin. Sie zeigt auf die nackten Betonstützen im Inneren der Lesesäle. »Die Bausubstanz scheint auf den ersten Blick völlig in Ordnung. Was man sicher neu machen muss, sind Fassadenteile und Dachflächen, aber auch die Haustechnik.« Schon vor Jahren hat der Stadtrat beschlossen, das Gebäude aus dem Jahr 1979 zu sanieren. Doch im Januar war plötzlich von Abriss die Rede. Es zeichnete sich ab, dass die Kosten der Sanierung von den zuletzt angepeilten 80 Mio. auf knapp 140 Mio. Euro steigen würden. Vor diesem Hintergrund müsse man neu denken, sagte der kulturpolitische Sprecher der CDU, Ralph Elster. Das »großartige Angebot« der Bibliothek verdiene auch eine »großartige Architektur«. In der Kölner Presse wurde das Gebäude als unansehnlich beschrieben und vor einem Desaster wie bei der Opernsanierung gewarnt, die nun schon elf Jahre dauert und inzwischen mit 674 Mio. Euro veranschlagt wird.
»Beim aktuellen Kenntnisstand sehe ich keinen Grund, die Zentralbibliothek abzureißen«, sagt dagegen Stefanie Ruffen. Am 16. Mai soll der Rat entscheiden. Die Debatte bewegt viele in der Stadt — weil die Bibliothek die mit Abstand bestbesuchte Kultureinrichtung in Köln ist, beliebt nicht nur beim Bildungsbürgertum. Andere Kulturinstitutionen wie das Literaturhaus protestieren und fordern, die lang geplante Sanierung rasch umzusetzen.
Widerstand gegen den Abriss von Gebäuden gab es oft. Meist wurde mit dem Denkmalschutz argumentiert, oder damit, dass ein Gebäude Wahrzeichen eines Viertels sei. Um den Erhalt von Baukultur ging es auch bei der Debatte um Schauspielhaus und Oper. Das Ensemble des Architekten Wilhelm Riphahn veranschauliche den Willen, der Kultur unmittelbar nach dem Krieg einen Platz im Zentrum der Stadt einzuräumen. Die Stadt plante zunächst, das Schauspielhaus abreißen und neu bauen zu lassen. Doch die Befürworter eines Erhalts setzten sich durch.
Widerstand gegen den Abriss von Gebäuden gibt es oft. Aber meistens geht es dabei nicht um den Klimaschutz
Mittlerweile haben Abrissgegner noch stärkere Argumente zur Hand. Denn was bei einem Neubau durchweg schlechter ausfällt als bei Umbau oder Sanierung, ist die CO2-Bilanz. Während die Republik über Gasheizungen und Wärmedämmungen, also die Emissionen im Betrieb, diskutiert, bleibt ein Aspekt häufig ausgeklammert: die Emissionen, die beim Bau anfallen. Die sogenannte Graue Energie, also die Energiemenge, die für Herstellung, Transport und andere Produktionsprozesse eines Gebäudes aufgewendet werden muss, geht bei einem Abriss verloren. Bei der Frage Sanierung oder Neubau müsse man deshalb den gesamten »Lebenszyklus« eines Gebäudes betrachten, fordern etwa die Architects for Future. Durch die Bewertung von Grauer Energie sei eine Sanierung jedem Neubau, selbst dem von Passivhäusern, vorzuziehen. Als Faustregel gilt, dass bei der Herstellung eines Gebäudes genauso viele Emissionen entstehen wie in 50 Jahren Betrieb — bislang ist aber diese Betriebsemission der Faktor, um den sich der Klimaschutz dreht. Laut Umweltbundesamt entfallen 30 bis 35 Prozent aller Emissionen hierzulande auf Errichtung, Erhalt und Betrieb von Gebäuden. Auch der Ressourcenverbrauch des Bausektors ist enorm: 50 Prozent der Rohstoffgewinnung wird für Baumaterial benötigt, und 2020 entfielen 55 Prozent des gesamten Abfallaufkommens auf Bau- und Abbruchabfälle. Deshalb, so das Umweltbundesamt, müsse es neben der Verkehrs- und der Energiewende auch eine Bauwende geben, die Umbau und Umnutzung des Gebäudebestands ins Zentrum rückt.
Auch am geplanten Abriss des Justizzentrums in Sülz entzündet sich die Debatte um Graue Energie. Das Gebäude-Ensemble wurde 1981 errichtet: 23 Stockwerke, 105 Meter hoch, und damit nur knapp 30 Meter niedriger als das rund zehn Jahre zuvor errichtete Uni-Center auf der anderen Seite der Luxemburger Straße.
»Der Bau ist ein solide errichteter Stahlbetonskelettbau und nach aller Erfahrung gut sanierbar«, sagt Thomas Scheidler, emeritierter Professor an der FH Aachen. »Stütze, waagerechtes Trägerelement, Deckenplatte, dann wieder Stütze — da ist nichts Kompliziertes dran und einem veränderten Innenausbau stehen nie tragende Wände im Weg.« Das Justizzentrum brauche zwar eine neue Fassade, neue Haustechnik und wohl eine neue Raumaufteilung, aber der Aufwand sei nicht zu vergleichen mit der Opern-Sanierung, die stets als Argument gegen Sanierungen angeführt wird. Dort gab es Probleme mit dem Beton aus den 50er Jahren. Ein Problem, das bei einer Sanierung des Justizzentrums eher nicht auftauchen werde, meint Thomas Scheidler. »Ein Betonbau aus den 70er Jahren oder später hält womöglich hundert Jahre. Da waren Betonnormen und Technik ausgereift.« Dennoch ist der Abriss beschlossene Sache. In einem Planungswettbewerb im vergangenen Mai war eine Sanierung des Justizzentrums gar nicht mehr vorgesehen. Der Bauherr des Gebäudes, der landeseigene Bau- und Liegenschaftsbetriebs (BLB), wollte unbedingt den Abriss. In einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung hätten »neben monetären Kriterien auch deutlich höhere energetische Standards Berücksichtigung gefunden«, so der BLB. Und die Stadt Köln teilte mit: »Im Ergebnis umfassender Voruntersuchungen wird eine komplette Neuordnung der Strukturen im Plangebiet als zielführend erachtet.« Aber was waren diese »umfassenden Voruntersuchungen«?
Statt einer Bau-Ordnung brauchen wir eine Umbau-Ordnung
Jörg Beste
Das wollte unter anderem Helmut Röscheisen, Vorstand des Kölner Kreisgruppe des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) Köln wissen und hakte nach. Doch Einsicht in das Ergebnisprotokoll eines Workshops, auf das der BLB seine Argumentation für den Abriss stützt, wollte man Röscheisen nicht gewähren. Daraufhin hat er Klage eingereicht. Röscheisen vermutet, dass Erhalt und Sanierung des Gebäudes nie ernsthaft in Betracht gezogen wurden.
Die Begründungen für den Abriss und einen Neubau lauten immer gleich: Die Anforderungen an die Nutzung des Gebäudes seien gestiegen und könnten in einem sanierten Gebäude nicht gewährleistet werden. Zudem seien Auflagen wie Barrierefreiheit und Brandschutz sowie die Anforderung an eine moderne digitale Infrastruktur in den Gebäuden nicht oder bloß mit unverhältnismäßig großem finanziellem und zeitlichem Aufwand zu erfüllen. Ein Paradox ist dabei oft der Verweis auf bessere energetische Standards in einem Neubau — eben weil beim Abriss all die Energie, die für den Bau eines Gebäudes aufgewandt wurde, verloren geht. Thomas Scheidler, der Röscheisen unterstützt, sagt: »Die schwarz-grüne Landesregierung müsste einen vorläufigen Stopp der Abrissplanung zum Justizzentrum verfügen und die Substanz vorurteilsfrei auf ihre Sanierungsfähigkeit überprüfen.« Scheidler verweist auf das ehemalige Lufthansa-Hochhaus in Deutz. Dort hat ein privater Investor sich für den Bestandserhalt entschieden — allerdings wohl nur, weil er bei einem Neubau nicht mehr die Genehmigung für die bisherige Höhe erhalten hätte. »So hat der Investor das Skelett des Gebäudes erhalten, das Innenleben und die Fassaden komplett erneuert und beim Umbau gab es, soweit bekannt, keine größeren Schwierigkeiten.«
Während die Debatte um Graue Energie gerade erst in Politik und Verwaltung ankommt, ist sie unter Planern und Architekten schon länger Thema. »In Köln haben sich die meisten bloß immer Abriss vorstellen können«, Jörg Beste, Geschäftsführer des Architektur Forum Rheinland, der auch als Berater im Stadtentwicklungsausschuss sitzt: »Die üblichen Projektentwickler wollen auch heute alles abräumen, um dann ihre Ideen in Reinform umzusetzen.« Der Architekt und Stadtplaner sagt, jenseits der Denkmalpflege seien bis vor kurzem nur wenige Projektentwickler auf Umnutzungen von Gebäuden spezialisiert gewesen. Die alten Industriehallen an der Mülheimer Schanzenstraße seien eine große Ausnahme. Beste plädiert für ein Umdenken: Statt für einen Bedarf einen Standort zu suchen, solle man Bestandsgebäude mit ihrem sozialen Umfeld betrachten und dann für sie eine neue Nutzung zu finden.
Aber die gesetzlichen Regelungen sind nicht auf Erhalt des Bestands ausgerichtet. »Statt einer Bauordnung brauchen wir eine Umbau-Ordnung«, so Beste. »Wir werden im Bausektor nie ohne radikale Bestandsnutzung zur Klimaneutralität kommen. Die Stadt von morgen besteht aus den Häusern von heute. Sie muss intelligent angepasst werden, um den vorhandenen Energieschatz retten und weiternutzen zu können, ohne neue Energien einbringen zu müssen.« Nur eine Bilanz, die Graue Energie berücksichtige, sei eine ehrliche CO2-Bilanz.
Es sind nicht nur markante Gebäude wie das Justizzentrum oder die Zentralbibliothek, über deren Zukunft jetzt entschieden wird. Ein großer Teil der Wohnhäuser, der Siedlungsbauten oder Großwohnsiedlungen Kölns stammt aus den 50er, 60er und 70er Jahren. Auch bei ihnen stellt sich bald die Frage: Sanierung, oder Abriss und Neubau?
Christiane Martin ist Fraktionsvorsitzende der Grünen im Stadtrat, die als stärkste Fraktion das Bündnis mit CDU und Volt anführen. »Das Ziel Klimaneutralität bis 2035 ist gesetzt«, sagt Martin. »Dafür brauchen wir erneuerbare Energien, etwa aus Solaranlagen auf unseren Dächern, aber wir müssen auch dringend den Bausektor in den Blick nehmen.« Zu lange sei vor allem auf die Energieeffizienz geschaut worden und nicht auf die Energie, die für den Bau aufgewendet wurde. Ein »Abriss-Moratorium«, wie es vergangenen Herbst rund 170 Vertreter der Baubranche, Architekten und Denkmalpfleger von Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) forderten, darunter neben Architects for Future auch
der BUND und der Bund Deutscher Architektinnen und Architekten (BDA), lehnt Martin ab. Auch im Kölner Stadtrat gab es einen Vorstoß für ein Abriss-Moratorium, initiiert von Linke und Klima Freunden. Doch eine Abstimmung darüber ist seitdem immer wieder im Bauausschuss vertagt worden.
»Man kann nicht pauschal sagen, wann ein Abriss oder wann eine Sanierung angemessen ist«, sagt Christiane Martin. »Die Sanierung sollte immer bevorzugt geprüft werden, aber sie wird nicht immer besser als ein Neubau sein.« Wenn man aber abreiße und neu baue, müsse man »nachhaltig bauen und die Fläche effizient ausnutzen, etwa indem man in die Höhe baut.«
Seit Ende 2022 liegt dem Rat ein umfassendes Gutachten vor, wie die Klimaneutralität bis 2035 erreicht werden kann. Darin geht es auch um Anforderungen an den Bausektor, vor allem ist von »nachhaltigen und ressourcenschonenden Bauen«, etwa unter »Verwendung von Baustoffen auf Basis nachwachsender Rohstoffe« die Rede. Zwar wird Graue Energie thematisiert, aber der Abriss von Gebäuden nicht ausdrücklich problematisiert. Der Neubau sei zwar »durch optimierte Flächennutzungen im Bestand sowie flächensparendes Bauen« zu reduzieren und »die Bestandssanierung anzustreben«, heißt es einmal. Aber auch das Gutachten konzentriert sich im Bausektor vor allem darauf, dass im Neubau »konsequent höchste energetische Gebäudestandards umgesetzt werden.« Im Gutachten werde deutlich, »dass es bei Neubauten darum geht, nachwachsende Baustoffe zu verwenden, wie etwa Holz, das zudem CO2 bindet, oder auch Hanf oder andere natürliche Fasern zur Dämmung«, sagt denn auch Christiane Martin. »Ich wünsche mir wirklich sehr, dass wir auch in Köln mal ein großes Gebäude aus Holz bauen. Dann wäre es auch nicht so schlimm, falls man es in dreißig Jahren abreißen müsste.«
Es wäre ein Gewinn, wenn wir unsere Städte erhalten könnten
Thomas Knüvener
Michael Kunz ist Vorstand der Projektentwicklers Proximus mit Hauptsitz in Köln. Vor einigen Jahren hatte das Unternehmen am Friesenplatz mit einem Partner unter anderem das Hochhaus gegenüber dem Foster-Bau gekauft. Kunz wollte den knapp 40 Meter hohen Bau aus den 60er Jahren abreißen und durch ein 99 Meter hohes Gebäude ersetzen lassen. Eine »absolutes Architektur-Highlight«, so Kunz damals gegenüber der Stadtrevue. Doch es regte sich Protest, bis auch der Stadtrat die Pläne ablehnte. Allerdings eher aus baukulturellen Gründen: Die Frage war, ob das Gebäude die Stadtsilhouette und den Blick auf den Dom störe. Graue Energie war damals kein Thema. Der Kompromiss: Proximus stockt nun bloß auf 67 Meter auf und nutzt knapp Dreiviertel des Bestands weiter. In einer Pressemitteilung der beiden Unternehmen ist nun von einer »nachhaltigen Transformation von Bestandsgebäuden« die Rede und Kunz sagt, man spare »eine große Menge CO2 ein.«
Nicht nur Investoren, auch viele Architekten sind noch immer auf den Neubau fokussiert. Bei einer Umfrage der Architects for Future gab etwa die Hälfte der Befragten an, nie einen Altbau saniert zu haben. »Die Faszination für das Neue ist riesig«, sagt Thomas Knüvener, Architekt und Vorstandsmitglied des BDA Köln. Dabei könne auch ein Umbau spektakulär sein, wie etwa die Kuppel des Reichstags. »Das sind auch psychologische Prozesse, sich von der Vergangenheit und deren Zeitgeist absetzen zu wollen. In der Nachkriegszeit hat man überall den Stuck von der Decke geschlagen — später wollte ihn jeder wieder haben.« Knüvener verweist auf alte Palazzi in Italien, in denen heute öffentliche Einrichtungen untergebracht sind. »Natürlich wirkt manches unvollkommen, aber das hat auch Charme.« Niemand wolle diese Gebäude abreißen. Auch Knüvener fordert, dass der Umbau erleichtert und von Auflagen befreit werden müsse. Stärkere Dämmung, Lüftung, höherer Lärmschutz: »Immer weitere Verschärfungen ergeben keinen Sinn, wenn sie sich ins Gegenteil verkehren und ich ein altes Gebäude abreißen muss, weil die neue Technik oder Dämmung nicht hineinpasst.«
Auch die Materialvielfalt, etwa bei Kunststoffen, verursache Probleme. »Alles wird komplexer, mit etlichen Schichten: Wärmedämmung, Schallabsorption nach innen, Schallschutz nach außen...« Auch die heutigen Wärmedämmverbundsysteme, all die Schaumstoffplatten, die auf Fassaden geklebt werden, würden einen riesigen Berg Sondermüll ergeben, weil sie sich nicht mehr trennen und recyceln lassen. Stattdessen müsse man lösbare Verbindungen und ökologische Werkstoffe bevorzugen, so Knüvener. Sanierungen würden zudem erschwert, weil heute pro Kopf viel mehr Wohnfläche beansprucht werde als früher. »Legte man die Wohnfläche pro Kopf aus den 80er Jahren zu Grunde, wäre das Wohnungsproblem viel geringer.« Knüvener sieht nicht nur einen Verzicht darin, die Ansprüche etwas herunterzuschrauben. »Es wäre auch ein Gewinn, wenn wir unsere Städte erhalten können und Gebäude, die die eigene Kindheit prägten, nicht alle verloren gehen.« Den Fokus auf den Umbau im Bestand zu legen, bedeute keinen Stillstand. »Darin liegt auch eine große Chance.«
Stefanie Ruffen, die Vorsitzende des Bauausschusses, plant mit ihrem Architekturbüro »zu 80 bis 90 Prozent« Bauvorhaben im Bestand. Das sei meist anstrengender, »und das ist das Problem.« Die Landesbauordnung sei
auf Neubauten ausgelegt, so Ruffen. »Es gibt so viele Gesetze, DIN-Normen und Verordnungen, die das Bauen im Bestand erschweren.« Sobald man größere Veränderungen vornehme, müsse man etwa die Energieeinsparverordnung berücksichtigen. »Das ist im Sanierungsfall viel schwieriger als beim Neubau.«
Besondere Auflagen gebe es zudem für öffentliche Bauten. Laut Bundeshaushaltsgesetz muss abgerissen werden, wenn eine Sanierung mehr als 80 Prozent der Kosten eines Neubaus ausmacht. »Solange diese Gesetze nicht geändert werden, bringt auch die Forderung nach einem Abrissmoratorium nichts«, so Ruffen. Sie gesteht jedoch zu, dass der politische Wille einen Einfluss darauf habe, wie die Rechnungen für Abriss oder Neubau geführt werden. »Man kann die Kosten kalkulieren, wie man es braucht. Sicherheiten und Baukostenentwicklung kann man ja nur grob schätzen«, sagt Ruffen und hält es für wahrscheinlich, dass etwa die Sanierung der Zentralbibliothek künstlich hochgerechnet sei, weil Teile von Politik und Verwaltung einen Abriss bevorzugen. Das Denken müsse sich ändern, so Ruffen: »Sanierung oder der Erhalt eines Gebäudes sollten der Normalfall sein. Für alles andere braucht
es eine echt gute Begründung.«
Aber warum sind überhaupt so viele Gebäude in einem so schlechten Zustand? Ruffen baut vor allem für Geldinstitute. Ihnen sei am Erhalt ihrer Bauten gelegen, die Gebäude seien meist auch gut instandgehalten. Bei öffentlichen Gebäuden sei das oft nicht der Fall. »Die Stadt hat kein Interesse, Gebäude instand zu halten und Geld dafür in den Haushalt einzustellen«, sagt sie. »Ein Politiker kriegt keinen Applaus, wenn er ein Gebäude gut pflegt, sondern nur, wenn er das rote Band durchschneidet.« Inzwischen bilde die Stadt Rücklagen für die Instandhaltung, aber das Geld reiche nicht — und es sollte auch nicht nur zurückgelegt, sondern müsse auch investiert werden, fordert Ruffen. Ihre Fraktion plane einen Antrag, dass für städtische Gebäude automatische Wartungsintervalle für Instandhaltung, aber auch Modernisierung eingeführt werden sollen, so die FDP-Politikerin. Bislang sei dafür kein Geld im Haushalt vorgesehen. »Ein Investitionsplan ist auf lange Sicht billiger, weil man nicht auf einmal vor einem Schrotthaufen steht. Instandhaltung macht Total-Sanierungen oft überflüssig oder verschiebt diese um Jahrzehnte.«
»Instandhaltung beginnt, sobald man fertig ist mit Bauen«, sagt Christl Drey, Architektin und im Vorstand des Hauses der Architektur Köln (hdak), das sich mit der Baukultur in der Stadt beschäftigt. Auch Drey fordert, dass für Umbau keine Neubau-Standards gelten. »Überregulierungen und Forderungen nach immer mehr Wohnfläche pro Kopf stammen aus Wachstums- und Reichtumsphasen.« Dies sei inzwischen überholt, nicht zuletzt aus Gründen des Klimaschutzes. Drey findet: Wenn sich die Frage nach Abriss oder Sanierung stellt, soll die Stadt bei größeren Bauvorhaben stets eine Alternativuntersuchung fordern, wie das Bestandsgebäude umgebaut werden kann — auch bei privaten Bauherren. »Diese Prozessforderung kann eine Kommune stellen. Die Politik muss sagen: Das wollen wir!«
Man könne fast alles umbauen, so Drey und nennt als Vorbild Belgien, wo der Umbau im Bestand ein großer Trend sei und es viele Auflagen wie hierzulande nicht gebe. Auch aus »billigen 60er-Jahre-Häusern« könne man etwas machen. »Das ist manchmal teurer, aber sinnvoller.« Baugruppen könnten etwa für einen Umbau »pfiffige Ideen« finden. Wohnungsbauunternehmen dagegen seien wenig flexibel. »Die haben die Prototypen für ihre Pläne schon in der Schublade.«
Man kann fast alles umbauen
Christl Drey
Drey erinnert daran, dass es in den 70er und 80er Jahren schon einmal eine große »Erhaltungsdebatte« gegeben habe, damals ging es um die Gründerzeithäuser in Berlin-Kreuzberg, die mit ihren Grundrissen und fehlenden Badezimmern den Anforderungen ans Wohnen nicht mehr genügten. »Da gab es ja Überlegungen, quasi ganz Kreuzberg abzureißen. In Köln hatten wir den Kampf um das Stollwerck-Gelände«, so Drey. Kreuzberg blieb stehen, vom Stollwerck immerhin noch der »Anno-Riegel« — die einst verpönten Häuser sind heute beliebt und teuer. »So wie die Menschen damals eingesehen haben, dass die Sanierung die bessere Wahl ist, sehen sie es vielleicht auch heute wieder ein, wo es eine größere Aufmerksamkeit gegenüber dem Klimawandel gibt.«
Im Mai entscheidet der Rat über die Zukunft der Zentralbibliothek. Doch schon steht der nächste Streit bevor. Die Bastei, ein weiteres Wahrzeichen von Wilhelm Riphahn am Rheinufer, ist marode. Die Bausubstanz gilt als derart schlecht, dass eine Sanierung unrealistisch erscheint. Soll man es abreißen und originalgetreu wieder aufbauen?
Und es steht die Sanierung von Philharmonie und Museum Ludwig an. Im März hatte der Kölner Stadt-Anzeiger aus einer Machbarkeitsstudie zitiert, die Kosten von bis zu 1,1 Mrd. Euro für eine Sanierung veranschlagt. Der Bau im Jahr 1986 hatte 260 Mio. DM gekostet. »Die Zahlen erscheinen absurd, zumal die Gebäude augenscheinlich in gutem Zustand sind und die Nutzung einwandfrei funktioniert«, sagt Stefanie Ruffen. Eine Variante sehe sogar vor, den Konzertsaal an anderer Stelle neu zu bauen. Was dann mit dem jetzigen geschehen soll, davon ist keine Rede
Auch der Abriss des Bezirksrathauses Rodenkirchen, ein Bauwerk der 60er Jahre, ist beschlossen. Das neue Gebäude soll Photovoltaik, Wärmepumpen und eine begrünte Dachterrasse bekommen. Zuvor aber wird hier viel Graue Energie beim Abriss vernichtet. Immerhin forderten die Grünen in der Bezirksvertretung nun den »klimaneutralen Abtransport« des Bauschutts — mit Lastenrädern. Die Pressemeldung stammt vom 1. April.