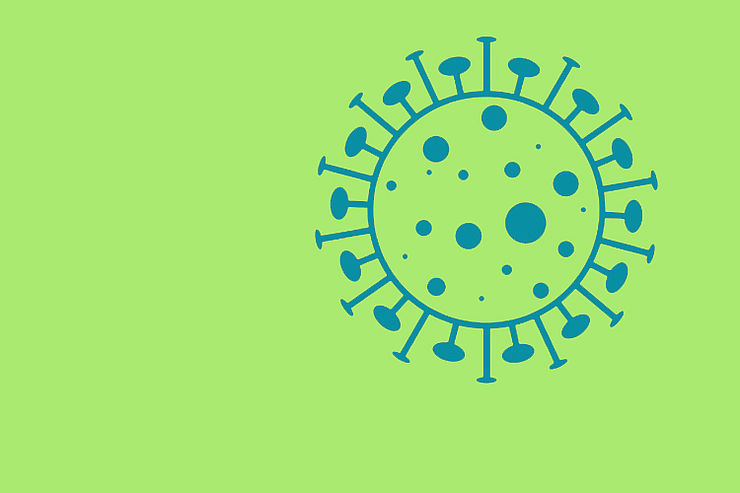Colonia Corona — Wie Köln dem Virus trotzt – Teil 2
Ein Fenster zur Straße
Inge Wilberg ist traurig über das Besuchsverbot im Altenheim
Ich bin 89 Jahre alt und wohne seit neun Monaten im Seniorenheim. Zu Hause ging es nicht mehr. Ich fühle mich hier wohl und bekomme regelmäßig Besuch. Über Fernsehen und Zeitungen bekomme ich mit, was in der Welt passiert. Jetzt reden alle nur noch über Corona. Man hört nichts anderes mehr. In den Nachrichten war am Anfang noch von den Flüchtlingen an der Grenze zu Griechenland die Rede, das ist kein Thema mehr.
Das Seniorenheim lässt Angehörige nur in Ausnahmefällen zu uns. Meine Enkelin ist noch ein Kind und darf gar nicht mehr kommen, dabei ist es immer lustig, sie kämmt mir die Haare. Seit ein paar Tagen macht mich das auch traurig, dass kein Besuch mehr kommt.
In meinem Alter gehöre ich zur »Risikogruppe«. Doch für mein Alter sei ich sehr fit, sagen die Pfleger. Ich habe meiner Familie gesagt, sie solle sich keine Sorgen machen. Ich komme ja nicht viel unter Menschen. Ich werde schon nicht an Corona sterben, dann wäre ich ja irgendwie prominent, das glaube ich nicht. Ich sorge mich eher um die anderen, die noch unterwegs sein müssen.
Ich habe ein kleines Zimmer mit Blick auf die Straße. Viele wollen ein Fenster zum Garten, ich bin froh über meine Aussicht. Auf der Straße ist immer viel los, es gibt eine Straßenbahnstation und ich sehe Leute aus- und einsteigen oder zum Supermarkt gehen. Mir fällt auf, wie viele Leute große Kisten raustragen. Dabei wird doch immer alles nachgeliefert.
Gestern hatten meine Schwiegertochter und meine Enkelin für mich ein paar Sachen eingekauft. Sie haben die Tasche am Eingang abgegeben, eine Pflegerin hat sie mir aufs Zimmer gebracht. Ich habe dann das Fenster geöffnet und mich mit den beiden auf dem Bürgersteig unterhalten. Ein Paar ging an den beiden vorbei, guckte hoch und lächelte. Ich bin wirklich froh, ein Zimmer zur Straße zu haben.
Protokoll: Bernd Wilberg
Fulltime-Job ohne Bezahlung
Gabriel Riquelme vom Club Bahnhof Ehrenfeld steht vor großen finanziellen Problemen
Wir betreiben den Club Bahnhof Ehrenfeld (CBE), das Yuca sowie die Event-Agentur Hush Hush, die unterschiedliche Party-Konzepte und viele Konzerte in allen möglichen Venues veranstaltet. Beide Bereiche sind von der Corona-Krise betroffen — aber unterschiedlich. In der Agentur fällt gerade unglaublich viel Arbeit an. Wir müssen Kontakt zu den Künstlern halten, damit wir ihre Konzerte nachholen können. Das ist ein Full-Time-Job, auch wenn wir gerade kein Geld damit verdienen.
Den CBE und das Yuca haben wir am 13. März geschlossen. Das war wichtig und richtig. Allerdings waren wir in einem Dilemma. Die Stadt hat eine »Handlungsempfehlung« raus gegeben, Clubs zu schließen, aber keine Verfügung erlassen. Damit mussten wir selber für alle finanziellen Ausfälle haften — das kann teuer werden. Aber weiter zu öffnen, stand aus gesellschaftlicher Verantwortung nicht zur Debatte. Wir wären auch Gefahr gelaufen, gegen das Infektionsschutzgesetz zu verstoßen. Von der Stadt Köln und dem Land NRW hätten wir uns gewünscht, dass sie deutlicher Position beziehen. Viele Kölner Clubs sind in der Klubkomm organisiert, die gerade Gespräche mit der Stadt führt, um für alle Lösungen in dieser Krise zu finden.
Im CBE und Yuca arbeiten 100 Menschen, davon 25 festangestellt. Für die Festangestellten können wir Kurzarbeitergeld beantragen, das ist aber auch ein harter finanzieller Einschnitt. Für den Rest suchen wir dringend nach Lösungen. Den Thekenkräften, Künstlern, Technikern und Technikverleihern ist das Einkommen komplett weggebrochen. Wer uns dabei unterstützen will und kann: Es hilft, schon gekaufte Karten jetzt nicht zurückzugeben, wenn die Veranstaltung ausfällt. Wir schauen, dass wir das Eintrittsgeld möglichst schnell mit den Betroffenen splitten können.
Wir müssen die Solidarität aber über den Kultursektor hinaus in die Gesellschaft tragen. Nicht nur wir haben Probleme, Miete und Versicherungen zu zahlen, sondern fast alle Menschen, deren Einkommen gerade wegfällt. Auch Vermieter sollten ihren Teil zur Überwindung der Krise beitragen. Gerade wird deutlich, wie schlecht der Kapitalismus für solche Situationen geeignet ist — ein privatisiertes Gesundheitssystem wie in den USA wäre eine Katastrophe. Hilfe von einem solidarischen Staat, aber vor allem Solidarität und Selbstorganisation sind Wege aus dieser Krise. Das sehe ich gerade überall in Köln, und das macht mir Hoffnung.
Protokoll: Christian Werthschulte
Irgendwie wie im Krankenhaus
Die siebenjährige Anna über ihre Corona-Ferien
Am Freitag hat unsere Lehrerin gesagt: Ich hoffe, wir sehen uns am Montag wieder. Das war dann nicht so. Meine Mama hat sich das schon gedacht, deshalb sollte ich mein Lies-mal-Heft und den Zahlenfuchs mit nach Hause nehmen. Jetzt ist frei wegen Corona-Virus. Das kommt auch immer im Radio. Vorher ging es um den Klimawandel, ich dachte schon, der sei vorbei. Aber mein Papa meinte, es kommt nur nicht mehr im Radio. Über den Klimawandel haben wir etwas in der Schule gelernt, über Corona nicht. Wir haben gezeigt bekommen, wie man richtig Hände wäscht. Ich wusste das schon, nur nicht, dass man die Fingernägel extra wäscht. Alles macht zu, auch Schwimmbäder, damit sich die Menschen nicht anstecken. Dass jetzt die Spielplätze abgeschlossen werden, finde ich doof. Ich weiß nicht, warum das so ist.
Ich spiele zu Hause, aber ich muss auch Lernzeit machen, eine halbe Stunde Mathe, eine halbe Stunde Deutsch. Und ein bisschen Sachunterricht, ich fahre mit meiner Mama und meiner Nachbarin, die noch im Kindergarten ist, in den Wald. Dass man nicht so viel Schule hat, finde ich toll. Auch, dass ich mit meiner Nachbarin spielen kann. Ich würde auch gern meine Freundinnen sehen, aber man soll nicht mit so vielen Kindern spielen. Irgendwie finde ich, es ist so, als wenn man in einem Krankenhaus ist, wo man spielen kann und wo es eine spezielle Schule gibt, man aber nicht so viel lernen muss. Also so ähnlich. Ich stell mir das so vor, ich war noch nie im Krankenhaus.
Protokoll: Bernd Wilberg
Fürchtet euch nicht
Südstadtpfarrer Hans Mörtter über Angst und Zusammenhalt
Wie gehen wir mit der Angst um? Das ist eine Frage, die wir uns auch hier in der Gemeinde der Lutherkirche stellen. Neulich planten wir noch einen gemeinsamen Gottesdienst von Juden, Muslimen und Christen. Dann musste er abgesagt werden, weil ein Beteiligter zu einem infizierten Menschen Kontakt hatte. Mittlerweile sind alle Gottesdienste in Köln abgesagt worden. Bis dahin hatte die Corona-Krise schon vieles verändert. Wir fassten uns beim Friedensgruß nicht mehr an den Händen, sondern legten sie uns gegenseitig auf den Kopf. Berührung muss weiterhin sein. Auch andere finden ja kreative Wege, die Jugendlichen grüßen sich jetzt, indem sie sich gegenseitig mit den Schuhen antippen. Es ist wichtig, in der Krise klug, aber auch mit Humor zu handeln.
Die Krise lehrt uns, achtsam zu sein, nicht nur, was Hygiene betrifft. Ja, es wäre fahrlässig, jetzt alte oder geschwächte Menschen zu umarmen, wir müssen verhindern, dass sie sich vielleicht anstecken. Aber ich kann dennoch bei diesen Menschen sein und fragen: Wie geht es Dir? Was brauchst Du? Wir tragen Verantwortung füreinander, wir müssen weiter einander zugewandt sein, wir müssen solidarisch sein: Was tut dem anderen jetzt gut? Was kann jeder dazu beitragen, wie können wir uns helfen? Dazu gehören Menschen, die jeden Tag eine halbe Stunde mit Menschen telefonieren, die zwangsläufig in Isolation geraten und den menschlichen Kontakt brauchen. Darum kümmern wir uns.
Wir müssen zusammenhalten, die Angst darf sich nicht zwischen uns stellen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Angst die Räume besetzt. Dafür braucht es neben Hygieneregeln auch Solidarität — und Gottvertrauen. Bald ist Ostern. »Fürchtet euch nicht«, sagt der Engel zu den Frauen am leeren Grab Christi.
Protokoll: Bernd Wilberg