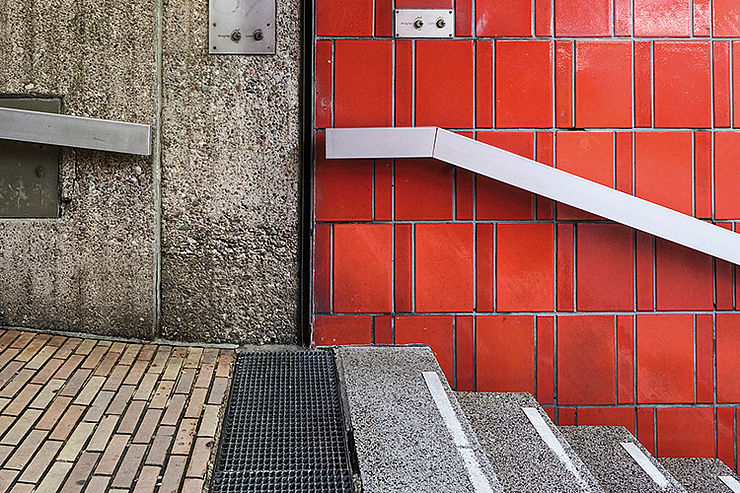Die neue Liebe zum Beton
Es ist ein trüber Vormittag auf dem Ebertplatz. Nur wenige Menschen halten sich hier auf, manche trinken Bier, andere kommen aus der U-Bahn und bleiben kurz stehen. Sie gucken auf das LED-Laufband auf dem Betondach der Passage, über das seit einigen Wochen Gedichte laufen. Burkhard Wennemar sitzt vor dem Brunnen, der in diesem Jahr pandemiebedingt noch nicht gesprudelt hat. Wennemar ist Vorsitzender des Bürgervereins Eigelstein, und er ist bestens gelaunt: Nur wenige Wochen zuvor hat der Stadtrat beschlossen, ein aufwändiges Umbauverfahren für den Ebertplatz einzuleiten.
Deutschlandweit war der Platz nach zwei Tötungsdelikten in der Dealer-Szene in Verruf geraten. Nun aber wurde der »Unort« zwischen Agnesviertel und Eigelstein zum städtebaulichen Vorzeigeprojekt der Zukunft auserkoren: mit einem »mehrstufigen« Wettbewerb und groß angelegter Bürgerbeteiligung soll eine städtebauliche Grundidee entwickelt und über die gewünschte Nutzung des Platzes entschieden werden.
Seit dem Jahr 2009 sieht der Städtebauliche Masterplan für Köln vor, dass der Ebertplatz ebenerdig gemacht wird. Doch nun wird auch untersucht, ob man die markante unterirdische Betonpassage erhalten kann — und das, obwohl viele gerade dieses Bauwerk für die Entwicklung des Platzes verantwortlich machen.
Noch erstaunlicher ist die Einmütigkeit, mit der dieser Beschluss getroffen wurde. Auch für CDU, SPD und FDP, die den 70er-Jahre-Betonbau stets so schnell wie möglich aus dem Stadtbild getilgt sehen wollten, scheint ein Erhalt der 70er-Jahre-Passage plötzlich denkbar. Was war passiert? Wann wurde das Rathaus zum Sammelplatz von Liebhabern brutalistischer Architektur? Woher kommt diese neue Liebe zum Ebertplatz? Und könnte sie auch wieder erkalten?
Lange hielt man in Köln einen ebenerdigen Umbau des Ebertplatzes für alternativlos. Unter dem Leitbild der autogerechten Stadt errichtet und 1977 eröffnet, bot der Platz schon Ende der 90er Jahre keinen schönen Anblick mehr. Der Brunnen auf der Platzmitte ging bald kaputt, ebenso die Rolltreppen zur Passage. Den dort ansässigen Ladenlokalen ging die Kundschaft aus, viele standen leer. Die Stadt sah dem Abwärtstrend weitgehend tatenlos zu. Erst, als im Herbst 2017 ein junger Mann bei Auseinandersetzungen zwischen Drogendealern starb, stand der Ebertplatz wieder im Fokus — als »Angstraum« und »Bausünde«.
Der Schuldige war ausgemacht: Der Platz selbst schien mit seiner verwinkelten, unübersichtlichen Betonarchitektur die Kriminalität anzuziehen, wenn nicht selbst hervorzurufen. Der damalige Stadtdirektor Stephan Keller wollte die Passage umgehend zumauern. Doch das geschah nicht. Stattdessen erlebte der Platz einen erstaunlichen Aufschwung. Künstler und Galeristinnen, die sich seit Mitte der Nullerjahre in den leer stehenden Lokalen der Passage eingemietet hatten, initiierten ein Programm, um den Platz wieder zu beleben. So begann das »Zwischennutzungskonzept«, mit Konzerten, Kunstinstallationen auf den stillgelegten Rolltreppen, und einem Gastro-Container auf dem Platz, das die Stadt mit 350.000 Euro pro Jahr fördert. Am wichtigsten war aber wohl die Reparatur des Brunnens: Seit die »Wasserkinetische Plastik« in der Platzmitte wieder sprudelt, wurde der Ebertplatz zum beliebten Treffpunkt im Veedel und zur Attraktion für die ganze Stadt. »Man verabredet sich mittlerweile auf dem Ebertplatz. Das finde ich wundervoll«, sagt Sandra Schneeloch, Ratsmitglied der Grünen. Schneeloch zog vor 12 Jahren zum ersten Mal in das benachbarte Agnesviertel. »Die Zwischennutzung ist ein voller Erfolg. Ich hoffe, dass der Platz weiter so belebt sein wird.«
Damit auf dem Ebertplatz wieder gespielt, getanzt und ein Café eröffnet werden konnte, war viel Bürgerengagement nötig. Unter dem Label »Unser Ebertplatz« gründete sich eine Struktur aus verschiedenen AGs, die sich mit der Begrünung des Platzes oder mit Fragen der Partizipation auseinandersetzen. Die Kunsträume aus der Passage sind dabei, ebenso das Bürgerzentrum Alte Feuerwache, das Programm für Kinder und Jugendliche anbietet. Das Kulturamt sponsort Musik, Kunst und Literatur, und Sozialträger, Politik und Polizei treffen in der AG Soziales aufeinander. »In den AGs arbeiten regelmäßig etwa vierzig bis fünfzig Menschen mit«, sagt Johannes Geyer. Er arbeitet beim Stadtplanungsamt und betreut als Stadtraummanager gemeinsam mit einer Honorarkraft das Projekt »Unser Ebertplatz«. Sie helfen bei der Antragstellung, kümmern sich um das Entleeren der Dixieklos und laden zu AG-Sitzungen ein. »Nicht allen liegt die Mitarbeit in den AGs, aber sie ist konstanter, als ich das erwartet habe. Andere engagieren sich lieber projektbezogen«, sagt Geyer.
»Wir haben das Konzept der Zwischennutzung erkämpft«, sagt Marc Müller, einer der Mitbetreiber der Galerie Labor, die seit 2005 in der Ebertplatzpassage zu Hause ist. »Nutzen und Putzen« heißt die aktuelle Ausstellung, die verschiedene Pläne für den Umbau vorstellt: von einem »grünen Archipel« über eine Markthalle in der Mitte des Platzes bis zur Nutzung der Passage für eine Kunsthalle. »Nach zehn bis fünfzehn Jahren kann man nicht mehr nur von Zwischennutzung sprechen, sondern von einer Nutzung«, sagt Meryem Erkus, die seit 2013 den Kunstraum »Gold + Beton« betreibt. »Der Platz funktioniert, wenn alle ein gemeinsames Ziel haben. Das ist auch in der Verwaltung angekommen.« Die Künstlerinnen, die hier in zentraler Lage eine günstige Miete zahlen, wollten die Passage schon immer erhalten — um einen Ort für nicht-kommerzielle Kunst in der Innenstadt zu haben, aber auch um brutalistische Betonarchitektur zu schützen. Sie halten den Platz für ein Unikat, dessen Probleme man nicht durch einen Umbau, sondern nur mit Sozialarbeit lösen kann.
»Anfangs war ich bei den Künstlern nicht gerade beliebt«, sagt Burkhard Wennemar vom Bürgerverein Eigelstein. Im Gegensatz zu diesen war der Verein nämlich ausdrücklich dafür, den Platz ebenerdig zu machen. »Das war damals politischer Konsens. Und auch wir dachten: die Leute wollen einfach nicht runter gehen, unten sein. Sie wollen oben sein, alles überblicken können.« Doch während der Zwischennutzung passierte etwas mit Wennemar. Das Engagement der Künstler, ihr Beitrag zur Belebung des Platzes, beeindruckte ihn.
Doch es waren nicht nur Sommerkino, Winter-Eisbahn und Rolltreppenkunst, die Wennemar überzeugten. Aus seiner Sicht sprechen auch ganz praktische Argumente gegen den ebenerdigen Umbau. »Unter der Passage verläuft eine U-Bahnlinie und auch irgendwo ein Düker, so ein großer Abwasserkanal.« Keiner wisse, welche weiteren Überraschungen in der Tiefe warteten. »Die Frage ist doch: Hält der Untergrund das aus, wenn man Tonnen von Erdreich da draufkippt, um den Platz ebenerdig zu machen?« Das müsse geprüft werden, sagt Johannes Geyer vom Stadtplanungsamt. Man erstelle ein Statikgutachten. »Der Ebertplatz besteht aus vielen Ebenen, das ist eine ziemliche Herausforderung für die Planung.«
Der Architekt Dieter Erlen teilt viele Bedenken. Aus seiner Sicht wäre es ein unangemessener Aufwand, die massive Betonpassage abzureißen. »Dazu braucht es schweres Gerät.« Die Kreuzung wäre monatelang unpassierbar, so Erlen. Einen derart komplizierten und teuren Umbau könne man nur verantworten, wenn das Bauwerk marode sei. Anfang März, kurz vor dem Ratsbeschluss, machte ein Gerücht die Runde, dass dies der Fall sei. Bei den Grünen setzte daraufhin eine Debatte ein, ob man den Erhalt der Passage noch unterstützen wolle. Erst eine Reihe von Gesprächen zwischen den Parteien, dem Bürgerverein und den Künstlerinnen konnte ihre Meinung ändern. »Es haben die Stimmen gewonnen, die gesehen haben, was das Engagement dort bewirkt hat,« sagt Sandra Schneeloch. »Dass jetzt beide Varianten geprüft werden, ist das Mindeste.«
Trotzdem bleibt Misstrauen. Die Stadtverwaltung selbst soll das Gerücht über den maroden Zustand des Betons gestreut haben. »Ich weiß nicht und kann nicht beurteilen, woher Gerüchte kamen«, sagt Johannes Geyer vom Stadtplanungsamt. Mit der turnusmäßigen Begutachtung des Betons durch die Stadt habe man festgestellt, dass er »in Ordnung« sei. Das ließe jedoch keine Schlussfolgerungen auf eine zukünftige Nutzung zu. Auch Wennemar vom Bürgerverein und der Architekt Dieter Erlen haben sich den Beton mit einem Fachmann angesehen. Er sei in einem »sehr guten Zustand«, so Erlen, und müsse womöglich nicht einmal saniert werden. Nun soll ein Gutachten Aufschluss geben.
Eine massive, intakte Betonkonstruktion einfach abzureißen und wegzuschmeißen, gilt heute aus Sicht des Klimaschutzes als No-Go. Wenn der Abriss großer Bauwerke vor allem aus den 60er und 70er Jahren zur Debatte steht, werden deshalb immer häufiger Forderungen nach Erhalt, Umbau und Umnutzung der Gebäude laut. »Durch jeden Um- und Rückbau habe ich einen gewissen Klimaausstoß«, sagt Johannes Geyer vom Stadtplanungsamt. Er erinnert daran, dass es gesetzliche Vorstöße gebe, die eine stärkere Nutzung bereits verwendeter Baumaterialien vor Ort vorsehen. »Urban Mining wird in der Zukunft der Bauwirtschaft eine große Rolle spielen.« Sandra Schneeloch von den Grünen möchte gerne den Baumbestand erhalten, der 26 verschiedene Arten umfasst: »In der Innenstadt können wir uns es nicht leisten, auch nur einen von denen zu fällen.« Neben den Bäumen erfülle auch der Brunnen eine wichtige Funktion: »Wenn Sie im Sommer am Brunnen sitzen, ist es dort kühler.«
Die ebenerdige Variante erscheint aus vielen Gründen nicht mehr zeitgemäß. Davon überzeugte der Architekt Dieter Erlen offenbar auch seinen Parteifreund, FDP-Fraktionschef Ralph Sterck, der stets vehement für einen schnellen, ebenerdigen Umbau gekämpft hatte. Unter dem Slogan »oben Park, unten Parken« wollte er zudem eine Tiefgarage unter dem Ebertplatz bauen. Nicht zuletzt die Machbarkeitsstudie für die Garage verzögerte die Planungen um Jahre, und letztlich verwarf man die Idee wegen der hohen Kosten.
Soll man den Ebertplatz also lieber so lassen, wie es die Künstler fordern? »Auf keinen Fall«, sagt Burkhard Wennemar vom Bürgerverein. Der Platz weise nach wie vor erhebliche Nachteile auf. Erstens, sagt Wennemar, müsse die Passage ihren »Fuchsbau-Charakter« verlieren, die vielen Treppenaufgänge geschlossen werden. In der nunmehr geschlossenen Passage könne man zum Beispiel eine Kunsthalle einrichten. »Die Zugänge zu schließen, fände ich okay«, sagt die Künstlerin Meryem Erkus. »Aber dort sollten Räume für Ausstellungen entstehen.« Marc Müller möchte die Passage zum Platz hin gerne offenhalten: »Wir in der Kunstwelt leben in einer Bubble. Eine offene Passage bricht das ein wenig auf.«
Mehr Konsens herrscht beim Thema Verkehr. Die Achse zwischen Eigelstein und Agnesviertel soll wiederhergestellt werden, Fußgänger und Radfahrer den Platz wieder ohne Umwege überqueren können. Außerdem müsse der Platz verkehrsberuhigt werden. Der Bürgerverein schlägt vor, die Autos von der Südseite des Platzes komplett zu verbannen, so dass der Ebertplatz direkt an den Eigelstein angebunden wäre. Autos könnten dann nur noch auf der Nordseite des Platzes fahren, einspurig in jede Richtung. »Die Führung über die Nordseite macht am meisten Sinn«, sagt auch Sandra Schneeloch von den Grünen, deren Parteizentrale am Nordrand des Ebertplatzes liegt.
Der Bürgerverein steckte viel Arbeit in eine Visualisierung seiner Vorschläge, schrieb Briefe an die Ratsmitglieder und Aufrufe an die Lokalzeitungen. Am Ende war auch die SPD umgestimmt — die Fraktionsmitglieder stimmten dafür, auch den Erhalt zu prüfen. Mit dieser Entscheidung sind jedoch nicht alle in der SPD glücklich. Mitglieder des Ortsvereins Innenstadt-Nord schrieben einen wütenden Protestbrief an Fraktionschef Christian Joisten. Die Ratsfraktion habe Wortbruch gegenüber den Wählerinnen und Wählern begangen, da die SPD sich in der Vergangenheit stets für den Abbruch der Passage eingesetzt habe.
Auf den Streit will Regina Börschel, stellvertretende Vorsitzende des SPD-Ortsvereins, nicht näher eingehen. Sie erklimmt eines der Holzdecks, die im Zuge der Zwischennutzung als Sitzgelegenheit auf den Platz gezimmert wurden. Mit ihrer Meinung zum Ratsbeschluss hält Börschel jedoch nicht hinterm Berg: »Ich finde das fatal. Der Beschluss ist mutlos und bedeutet, dass hier auf unbestimmte Zeit weiter nichts passiert.« Börschel hatte stets auf eine schnelle Umgestaltung gedrängt — Jahre, bevor der Platz in die Schlagzeilen kam. Sie forderte schon Interimsmaßnahmen, lange bevor die Stadt ihr erfolgreiches Zwischennutzungskonzept auflegte. Sie zeigt auf eine der stillgelegten Rolltreppen, die kürzlich zur Rutsche umfunktioniert wurde und von Kindern aus dem Veedel freudig genutzt wird. »Ich gestehe, ich bin auch mal gerutscht«, sagt sie. »Aber ist die Rutsche wirklich die Lösung?«
Aus kriminalpräventiver Sicht würde der Platz heute nicht mehr so gebaut werden, sagt Börschel. »Das ist ein stadträumlicher Fehler, den die Polizei nicht ständig ausgleichen kann.« Aus ihrer Sicht hat die Debatte um den Platz eine Schieflage bekommen — man betrachte einseitig aus dem Blickwinkel der Kultur, der Künstler. Der Platz sei eben nicht für alle da, auch wenn diese das gerne behaupteten. »Der Platz ist mit Rollator oder Kinderwagen nur über Umwege zu erreichen. Und viele fühlen sich hier immer noch nicht wohl.« Nicht nur Alte, auch Schülerinnen und Schüler würden die Passage nach wie vor meiden, sagt Börschel. »Zu einer modernen Platzgestaltung gehört die Frage der Zugehörigkeit und Barrierefreiheit aber dazu.«
Regina Börschel schaut auf den trockenen Brunnen, um den ein paar Kleinkinder auf ihren Laufrädern herum flitzen. Der Brunnen, die Kultur, das habe vieles verbessert, gibt sie zu. Aber die Zwischennutzung koste eine Menge Geld. »So wird der Ebertplatz immer am Tropf städtischer Mittel hängen. Ein guter Platz muss aber aus sich heraus funktionieren.«
Genau das ist bereits das Ziel des Stadtplanungsamts. »Wir treten bei der Zwischennutzung in die zweite Phase ein«, sagt Johannes Geyer vom Stadtraummanagement. Die Stadt will »die Betreuung des Gesamtprozesses effizienter gestalten«. Nach Corona fehlen ihr Ressourcen. So sollen die verschiedenen AGs in monatliche Arbeitstreffen überführt werden. Außerdem gebe es Überlegungen, wie man ein Nutzungskonzept am Platz organisatorisch und finanziell unterstützen könne — etwa durch die Gründung einer Genossenschaft oder eines Vereins. »Für uns ist außerdem eine wichtige Frage, wie wir weitere Milieus erreichen«, sagt Geyer. »Im Moment arbeiten bei uns vorrangig benachbarte Bürger und die Kreativszene mit, während Familien und alte Menschen eher den Platz und den Brunnen nutzen.«
Regina Börschel von der SPD fühlt sich an die Sanierung von Oper und Schauspiel erinnert. Künstler und Bürgerinnen starten eine Kampagne für den Erhalt eines Bauwerks, die Politik knickt ein — und am Ende müsse die Stadtgesellschaft womöglich die nächste unendliche Baugeschichte ausbaden, so sieht es Börschel. »Das Schlimmste, was dem Ebertplatz passieren könnte, wäre eine weitere ›Kölner Baustelle‹«, hält die Künstlerin Meryem Erkus dagegen. Sie befürchtet, dass ein großflächiger Umbau nicht nur länger dauern würde als geplant, sondern auch mit Mehrkosten verbunden wäre.
»Natürlich kann der Platz nicht so bleiben, wie er ist. Die Nachteile sind ja offensichtlich«, sagt Thomas Knüvener. Der Kölner Architekt hat 2019 eine Diskussionsreihe auf dem und über den Ebertplatz veranstaltet, mit Menschen verschiedenster Fachdisziplinen. In einem sei man sich relativ einig gewesen, so Knüvener: »Man sollte mit dem jetzigen, zweigeschossigen Platz umgehen und dessen Potenziale weiterentwickeln.« Der nachhaltige Umgang mit Ressourcen spiele da im Gegensatz zu früheren Zeiten eine wichtige Rolle. Aber Knüvener spricht noch etwas anderes an. »Wie man am Neumarkt sieht, gehen die sozialen Probleme durch die Ebenerdigkeit ja nicht weg.« Er plädiert für einen Umbau in kleinen Schritten. »Die Frage ist nun: Will man alles zurückdrehen oder auf dem Vorhandenen aufbauen?« Viele Passagen in Deutschland aus den Zeiten der autogerechten Stadt seien inzwischen zugeschüttet. In Köln habe man nun die Chance auf ein Alleinstellungsmerkmal, eine Art dreidimensionalen Platz mit »eingegrabenem« Gebäude. »Das könnte ein Kunsthotspot werden«, so Knüvener.
Ob die Kölnerinnen und Kölner ähnliche Vorstellungen haben, wird sich bei der Bürgerbeteiligung zeigen. Für deren Ausrichtung wird gerade ein Kommunikationsbüro gesucht. »Das Büro steht vor einer komplexen Aufgabe, weil es neben guter Kommunikation auch einen Hintergrund in der Architektur und im Stadtraum haben muss«, sagt Johannes Geyer vom Stadtplanungsamt. Auch seien die Beschlüsse des Stadtrats und das Gesamtverfahren zum Ebertplatz sehr anspruchsvoll: »Wir müssen da auch immer nochmal hineinsehen.« Marc Müller von der Galerie Labor ist es wichtig, dass sich das Büro mit der Geschichte des Platzes auseinandersetzt: »Wir haben da in den letzten 15 Jahren viel ausprobiert.« Für die nähere Zukunft plant das Stadtraummanagement regelmäßige public assemblies, also Bürgerversammlungen auf dem Platz, auch ein Reallabor für die Verkehrsführung sei vorstellbar, so Johannes Geyer. »Ich plädiere aus fachlicher Sicht dafür, in der Debatte um den Ebertplatz von den Extremvarianten wegzukommen«, sagt er. »Man sollte mögliche Nutzungen in den Vordergrund stellen.«
Vielleicht kommt am Ende ein großer Spielplatz, Fitnessgeräte oder ein genossenschaftlicher Biergarten auf den Ebertplatz? Selbst dann bleibt eine Frage offen. Was ist mit den Menschen, an deren Anwesenheit sich der Konflikt erst entzündet hat? Die Polizei überwacht den Ebertplatz seit geraumer Zeit mit Kameras, um den Drogenhandel zu verhindern. »Dadurch hat sich das Geschäft in Richtung Eigelstein verlagert«, sagt Marc Müller. Im Herbst 2020 wurde seine Galerie zum Büro zweier Sozialarbeiter. Sie sprachen mit den Menschen, die den Ebertplatz täglich ansteuern, darunter Menschen mit Alkoholproblem und solche, die dort Drogen verkaufen. Viele von ihnen sind als unbegleitete Jugendliche nach Deutschland geflohen und brauchen Hilfe bei ihrem Asylantrag oder der Suche nach einer Unterkunft. Von den Sozialarbeitern werden sie diese nicht bekommen: Das Projekt lief nach elf Wochen aus. Sandra Schneeloch hat noch eine weitere Idee. Falls die Grünen im Herbst die Bundestagswahl gewinnen, solle am Ebertplatz ein wissenschaftlich begleiteter Modellversuch zur legalen Abgabe von Cannabis gestartet werden. »Köln probiert zu wenig aus«, sagt sie. »Hätten die Dealer keine Kundschaft, würden sie hier nicht stehen.«
Eins sei klar, sagt Architekt Thomas Knüvener. Ein gemütlicher Veedelsplatz wie der Lenauplatz in Ehrenfeld oder der Sudermanplatz im Agnesviertel könne der Ebertplatz nie werden, allein schon wegen seiner Größe und Bedeutung als Verkehrsknotenpunkt. »Aber ich glaube, Köln kann so einen Platz vertragen.«