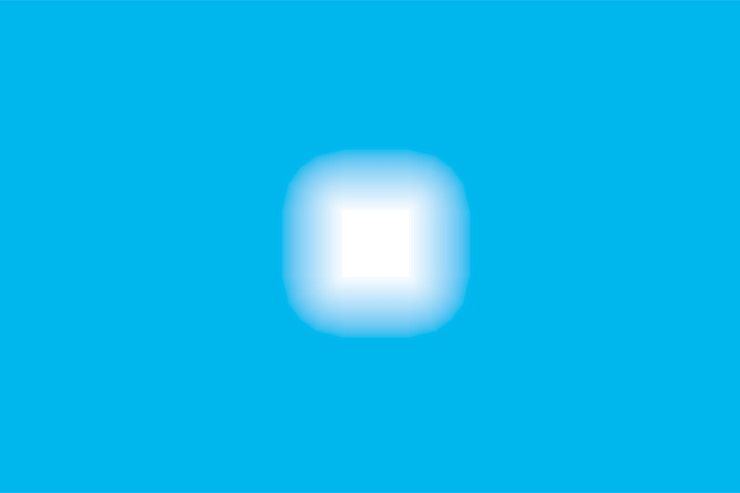Unter dem Rendering liegt der Strand
Wer Visionen hat, der geht in Köln nicht zum Arzt, sondern zum Architekturgrafiker. Die Kölner Stadtgeschichte ist voll von nicht realisierten Entwürfen für ein schnelleres, höheres und spektakuläreres Köln. Heute gehen wir auf ihren Ruinen spazieren. In den 60er Jahren sollte die Innere Kanalstraße zu einem Stadtautobahn-Ring ausgebaut werden. Geblieben ist davon die Zoobrücke, deren Auf- und Abfahrten Deutz und Mülheim zerteilen. Auch die Senke im Lohsepark, in der heute eine Skateboard-Anlage steht, ist ein Überbleibsel dieser Planungs-Fantasie — und ein Symbol, wie man es besser machen kann. Die Halfpipe wurde von einem Skateboard-Verein entworfen und gebaut, der sich auch um die Pflege kümmert. Bürger-engagement statt Masterplan.
Eine Garantie für eine bessere Stadtplanung ist aber auch das Engagement der Bürger nicht. Spuren davon findet man am Offenbachplatz. Eine Initiative aus der Kulturszene verhinderte den Abriss des Schauspielhaues, stattdessen wird es gemeinsam mit der Oper saniert. Dieses Projekt aber geriet zum Debakel: Die ursprünglichen Baukosten von rund 250 Mio. Euro haben sich ebenso wie die Bauzeit mehr als verdoppelt. Und die großen Parteien wollen die Straßenbahn auf der Ost-West-Achse in eine U-Bahn umwandeln. Damit steht schon die nächste Großbaustelle in der Innenstadt an. Dass sie ohne Verzögerung fertiggestellt wird, ist unwahrscheinlich.
Wie sollte eine Stadt, in der es Jahre dauert, die Symbole für eine Fahrradstraße auf die Fahrbahn zu pinseln, in der Lage sein, eine Verkehrswende zu schaffen?
All das befördert einen Zynismus: Stadtplaner, Bürgertum und Lokalpolitik sollen das Träumen bleiben lassen und stattdessen dafür sorgen, dass das Nötigste in Köln funktioniert. Wie sollte eine Stadt, in der es Jahre dauert, die Symbole für eine Fahrradstraße auf die Fahrbahn zu pinseln, in der Lage sein, eine Verkehrswende zu schaffen?
Aber vielleicht sind ja weniger die Visionen eines anderen Kölns das Problem, sondern dass wir diese Visionen an die Falschen outgesourced haben. Anstatt zu überlegen, wie denn ein Konzerthaus aussehen könnte, in dem die Musik Kölns zwischen A-Musik und Kasalla, zwischen Xatar und Karl-Heinz Stockhausen zwischen Jacques Offenbach und Mülheim Asozial einen Platz hat, haben wir zugelassen, dass das Kulturbürgertum sein Haus wieder für sich reklamiert, um letztlich einem Kulturbegriff aus dem vergangenen Jahrhundert eine neue Schlafstätte zu geben. Und beim Verkehr verstricken sich die verschiedenen Initiativen in den statistischen Vorgaben des Verkehrsdezernats, als seien diese der Horizont des Möglichen und nicht seine institutionell vorgegebene Grenze.
Ironischerweise führt dies dazu, dass selbst kaum umsetzbare Entwürfe zur Stadtplanung auf große Resonanz in der Bevölkerung stoßen. Im Mai erklärte der Architekt Paul Böhm, dass er die Gleise auf der Hohenzollernbrücke und am Hansaring in einen Park verwandeln wolle — in etwa 30 bis 40 Jahren. Dass Böhms schlampig gemachte Computer-renderings auch von der Stadtspitze diskutiert worden sind, liegt nicht nur am Renomee des Architekten der Ehrenfelder Moschee, sondern auch daran, dass Köln das Bedürfnis nach Parks und Plätzen mit guter Aufenthaltsqualität nicht befriedigt. Und wo es entsprechende Initiativen gibt, sind sie damit beschäftigt, Schlimmeres abzuwenden — wie die Initiative »Grüngürtel für alle«, die sich dagegen wehrt, dass der 1. FC Köln sein Trainingsgelände erweitert und dafür den Grüngürtel bebaut.
»Nichts ist zu gut für die einfachen Leute«, hat der Architekt Berthold Lubetkin mal gesagt. »Einfache Leute«, das sind die meisten von uns. In London hat Lubetkin nach dem Zweiten Weltkrieg versucht, diesem Vorsatz Bauten folgen zu lassen. Seine Wohnblöcke haben die damals avantgardistischen Formen des Modernismus in den öffentlichen Wohnungsbau eingeführt. Für Lubetkin waren Architektur und Stadtplanung Mittel der Aufklärung, »die indirekt auf die Transformation unserer gegenwärtigen Fantasieprodukts-Gesellschaft zielen, in der Bilder die Realität ausstechen und die Auszeichnungen die Errungenschaften übersteigen«. Genau deshalb widmete er der Gestaltung der Zwischenräume — Treppenhäuser, Gärten und Höfe — ebenso viel gestalterische Aufmerksamkeit wie den Wohnräumen selbst. Wohnen sollte nicht nur Privatsache sein. Eine Vision, von der heute Neubaugebiete im retromodernistischen Stil übrigbleiben, die maximal verdichtet sind, um dem teuren Baugrund mehr Profit zu entlocken. Auf den Webseiten ihrer Immobilienfirmen werden sie mit Hilfe von Weitwinkel-Objektiven zu anlegerfreundlichen Wohnobjekten — inklusive eines Wohnriegels mit Sozialwohnungen an der Durchgangsstraße oder Bahnstrecke, der die hochpreisigen Wohneinheiten vor Lärm schützt.
Dass es soweit kommen konnte, liegt nicht nur am Profitdenken der Immobilienwirtschaft, sondern auch daran, dass ein Gegenentwurf abhanden gekommen ist. Denn in den vergangenen Jahren wurde in Köln über Wohnungen, Parks oder Radwege zuerst als Mangel gesprochen — es gibt einfach nicht genug davon. Das stimmt natürlich. Aber nur weil Wohnraum knapp ist, müssen es Ideen ja nicht auch noch sein.